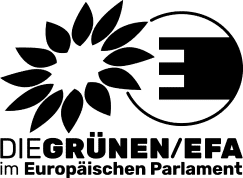WAS FOLGT WIRD NICHT EINFACH ZU LESEN – ABER WICHTIG IST ES TROTZDEM.
[English version published in the Guardian here]
Vor zwei Wochen bin ich in ein Flugzeug gestiegen und nach Lesbos geflogen. Vom Flughafen Mytilene ging‘s dann weiter mit dem Auto nach Moria. Moria ist ein kleines Dorf mit Blick über das ägäische Meer. Das Wasser ist klar, in der Ferne sieht man die türkische Küste – nur 8km entfernt. Der perfekte Urlaubsort. Von Tür zu Tür von Brüssel hat mich das 5 Stunden gekostet.
In den letzten vier Jahren haben die meisten Politiker immer ziemlich abstrakt über die Flüchtlingskrise berichtet: viele, große Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann, komplizierte oder vage Stellungnahmen, die irgendetwas zum 50sten mal verurteilen oder bedauern – im Grunde aber kaum was verändern. Was ich jetzt schreibe, wird daher weder abstrakt, noch werde ich viel eurer Vorstellung überlassen.
Von dem Dorf Moria sind wir zu einer ehemaligen Kaserne gefahren, die idyllisch in einem Olivenhain liegt. Je näher man der Kaserne kommt, desto mehr Menschen laufen am Straßenrand hin und her. Am Anfang sind es nur wenige, dann immer mehr, und am Ende sind es so viele, dass wir anhalten und parken müssen. Manche stehen auch, oder sitzen und reden. Als ich aus dem Auto steige und zum Lager laufe, fällt mir auf, das irgendwas nicht stimmt. Ich hätte viel mehr Lärm erwartet – aber man hört eher unterdrückte Stimmen und Schritte von Menschen, die sich durch das Tor drängen. Ich sehe alle möglichen Gesichter: Junge, alte, Frauen mit Kindern, Kinder ohne Mütter, Männer mit Verletzungen.
Nachdem ich die offiziellen Baracken hinter mir gelassen habe, in denen die griechischen Behörden sitzen, sehe ich zuerst mehrere Reihen von Zelten, Hallen, und Plastikhütten – ein bisschen erinnert es an eine Baustelle. Und dann fängt es an zu riechen – so wie es halt riecht, wenn viele Menschen mit beschränktem Zugang zu sanitären Einrichtungen auf engem Raum zusammenleben. Am Ende des eigentlichen Lagers sieht man noch ein größeres Chaos – mit selbstgemachten Zelten und Schachteln unter den Olivenbäumen. Daneben liegt Müll. Und neben dem Müll weitere Menschen. Hunderte Menschen, die auf Neuigkeiten zu ihrem Asylbescheid warten. Manche warten schon über 2 Jahre.
In der Nacht, sagt man mir, wird es schlimmer. Einige Frauen benutzen lieber Windeln, um im Bett bleiben zu können und sich nicht der Gefahr aussetzen zu müssen, vergewaltigt oder sonst wie belästigt zu werden; oder damit sie nicht das Risiko eingehen, dass ihnen ihr Zeug gestohlen wird. Aber Worte wie ‚Gefahr‘ oder ‚Risiko‘ fühlen sich in diesem Kontext irgendwie falsch an. Warum? Weil es Raum für Zweifel lässt. Es lässt es im Unklaren, ob diese schrecklichen Sachen wirklich passieren, oder ob sie nur ein ‚Risiko‘ darstellen. Aber jetzt weiß ich es.
Hier ist überhaupt nichts abstrakt dran. Frauen werden vergewaltigt. Regelmäßig. Und jede Nacht gibt es Stechereien, wird etwas gestohlen oder mit Gewalt geraubt. Jede einzelne Nacht.
In der Abwesenheit eines funktionierenden Systems halten wir die Menschen hier in einer schrecklichen Schwebe, in sie unter den widrigsten Bedingungen und ohne Perspektive auf Verbesserung vor sich hinvegetieren. Und wir schaffen alle diese Probleme selber, in dem wir die Menschen traumatisieren, deprimieren und einsperren. Die Ärzte im Camp, von denen es viel zu Wenige gibt, sagen, dass die psychischen und physischen Konsequenzen schrecklich sind. Die Menschen leben für viel zu lange auf viel zu engem Raum, ohne Perspektive und in endloser Abrufbereitschaft, oft ohne genug zu essen, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung und oft auch ohne Dusche oder Klo.
Es ist eine humanitäre Krise – und das auf europäischem Boden. Als ich hier im Camp den Geschichten der Menschen zuhöre, bin ich nicht mehr stolz, Europäer zu sein. Und wie könnte ich auch stolz sein, wenn ich machtlos zuschaue, wie Menschen um mich herum sterben? Unser Kontinent, der der erste emissionsfreie Kontinent der Welt und der Star im digitalen Zeitalter werden will, ist der gleiche Kontinent, der Menschen hungern und sterben lässt – nur 5 Stunden von Brüssel entfernt.
Es wurde langsam spät, also bin ich ins Auto gestiegen und die 10 Minuten nach Mytilene zurückgefahren. Dort habe ich ins Hotel eingecheckt, einen guten griechischen Salat gegessen, um dann müde in mein gemütliches Bett zu fallen. Im Hintergrund hörte man das beruhigende Geräusch von Wellen am Kai. In dieser Nacht sind 262 Asylsuchende an der Küste angekommen, nur wenige Kilometer nördlich von dem Hotel wo ich Netflix schaue, um mich von den Eindrücken des Tages abzulenken. Ich versuche zu schlafen.
Am nächsten Tag treffe ich eine Reihe von Menschen, die hierhergekommen sind, um zu helfen. Sie kommen von überall, angezogen davon, dass sie nicht einfach zuschauen wollen. Sie müssen etwas tun, irgendwas. Anwälte, Ärzte, Psychologen, Unternehmer, Studenten, Fitnesstrainer, Grundschullehrer und Fahrradmechaniker. Sie helfen Grundbedürfnisse zu befriedigen, Grundrechte zu schützen und etwas Beschäftigung zu schaffen. Zum Beispiel in dem sie Windeln an Frauen aushändigen, damit sie nachts nicht belästigt werden. Aber trotz einer engen und starken Gemeinschaft und trotz der enormen Motivation durch den klaren Sinn ihrer täglichen Arbeit, schauen sie mich mit Wut, Frustration und Enttäuschung an.
Ich fühle mich beschissen, wenn sie mich fragen: Na, was ist der Plan, Damian? Manchmal will ich dann erklären, wie die Kommission funktioniert, das Parlament, oder warum die Mitgliedsstaaten sich auf keine gemeinsame Verhandlungsposition einigen können – aber dann höre ich auf. Sie fragen mich nicht, warum es in der Theorie nicht funktioniert. Sie fragen mich im Namen derer, mit denen sie gerade heute gearbeitet haben. Und gestern. Und am Tag davor.
Sie fragen mich für den Jungen, der nur eine Woche vor meiner Ankunft an Fieber gestorben ist, weil er nicht richtig versorgt werden konnte. Für die 1200 unbegleiteten Minderjährigen, die unter den Olivenbäumen frieren. Ohne Betten, ohne Eltern, einfach warten. Sie fragen mich für die Gemeinschaftsleiterin im Camp, 22 Jahre alt, die ihre Tage damit verbringt, im Krankenhaus zu übersetzen und ihre Landsleute zu informieren und zu beruhigen. Sie fragen mich nicht, warum die Kommission nichts tut, warum das Parliament alleine machtlos ist, und warum die Innenminister versagen. Nein.
Sie fragen mich für die 15.392 Menschen die in diesem Camp zur Zeit meines Besuches leben. Sie fragen mich selbst als Menschen, die sehen wie wir versagen und keine Lösungen finden, Menschenleben zu retten.
Und erst dann verstehe ich wirklich: Europa hat keinen Plan. Und das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich schäme, Europäer zu sein. Jetzt frage ich selber, noch stärker als vorher: Was ist der Plan, Frau von der Leyen? Premierminister Mitsotakis? Kanzlerin Merkel? Präsident Macron? Fühlt ihr die Dringlichkeit der Situation? Wisst ihr, dass jede Nacht, die wir versagen und keine Lösung finden, Frauen der Vergewaltigung ausgesetzt sind, Kinder sterben und jemand abgestochen werden kann? Was ist der Plan, Europa?
Verhandlungen können schwer sein, klar. Aber wir kriegen es ja auch hin, uns auf einen gemeinsamen Haushalt zu einigen, wo jeder seinen gerechten Anteil kriegt.
Ich erwarte nicht, dass wir sofort eine Antwort auf die großen Fragen finden. Im Gegenteil, ich will alle einladen, gemeinsam mit mir darüber nachzudenken, wie eine logische Antwort aussehen könnte. Ich verstehe, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt – einige, die sich mehr auf Rückführungen konzentrieren, andere, bei denen es eher um Verteilungsmechanismen geht. Aber ich erwarte, dass wir ehrlich sind, dass wir den Gesetzen und den Werten unseres Kontinents genügen; dass wir Systeme und Prozesse entwickeln, die funktionieren; dass wir kurzfristige Maßnahmen einleiten, die der Größe der Herausforderungen, dem kommenden Winter und dem Leid vor Ort Rechnung tragen. Diese Situation nicht zu lösen ist nicht nur grausam, es ist unmenschlich, dumm und wird lange Auswirkungen für die Leben der Betroffenen als auch für die zukünftige Stabilität unseres Europas haben.
Haben mir die Tage in Lesbos die Augen geöffnet? Ja. Empfehle ich allen Abgeordneten aller Parlamente, den Kommissaren und den Innenministern selbst dorthin zu reisen? Ja, das tue ich. Wenn wir das Problem weiter abstrakt bearbeiten, werden unsere Antworten auch weiter abstrakt und unzulänglich bleiben.
Vor Ort hat mir jemand von einem passenden, griechischen Sprichwort erzählt: Man kann einen Elefanten nicht unter einem Stein verstecken. Wenn wir uns weiter abwenden und ignorieren, dass Menschen hier ihr Leben lassen, verstehe ich nicht, wie irgendeiner von uns stolz sein kann, in einem gewählten oder anderen öffentlichen Amt zu sein.